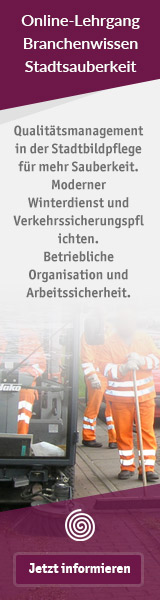Rechtliche Themen, die kommunale BetriebsstûÊtten im Blick behalten sollten

LûÊngst geht es fû¥r kommunale Betriebe nicht mehr ãnurã darum, die LebensqualitûÊt vor Ort zu sichern. Der Fokus rû¥ckt zunehmend darauf, festgelegte Umweltziele zu erreichen und nachhaltig zu handeln. Entsprechend stark verûÊndern sich auch die Anforderungen fû¥r die Fû¥hrungskrûÊfte in der Kommunalwirtschaft.
WûÊhrend die grundlegenden Aufgaben weiterhin dieselben bleiben, formen Nachhaltigkeitsbestrebungen und digitale Technologien ihre Rahmenbedingungen neu. BetriebsstûÊttenleiterinnen und -leiter mû¥ssen technisch versiert, organisatorisch geschickt und sozial kompetent sein. Hinzu kommt, dass sie die Kosten optimieren und û¥ber die aktuelle Gesetzeslage Bescheid wissen sollten. Zwei der rechtlichen Themen, die es derzeit im Blick zu behalten gilt, betrachten wir im Folgenden nûÊher.
ãIntelligenteã StûÊdte benûÑtigen ausreichenden Schutz vor CyberkriminalitûÊt
Es gibt zahlreiche StûÊdte und Kommunen, die sich bereits aktiv mit dem Thema ãSmart Cityã auseinandersetzen und in diesem Bereich innovative Projekte umsetzen, um intelligenter, nachhaltiger und lebenswerter zu werden. Wichtige Akteure bei der Umsetzung von ãSmart Cityã-Projekten sind die kommunalen BetriebsstûÊtten, die durch ihre Infrastruktur und Expertise einen wesentlichen Beitrag leisten kûÑnnen.
In den letzten Monaten ist Cybersicherheit vor allem fû¥r die Infrastruktur in Deutschland ein existenzielles Thema geworden. Auch Entsorgungsunternehmen geraten verstûÊrkt ins Visier von Hackern. Um vor Phishing-E-Mails, Malware-Infektionen, Social-Engineering-Angriffen und weiteren Cyberattacken geschû¥tzt zu sein, sind Systeme zur Angriffserkennung essenziell. Denn ein Angriff kann nicht nur sehr teuer sein, da sie den Betrieb beeintrûÊchtigen, sondern auch das Unternehmensimage und das Vertrauen der Kundschaft in die Sicherheit der Dienstleistungen beeintrûÊchtigen.
Mit der geplanten Novelle des IT-Sicherheitsgesetzes sollen die Sicherheitsanforderungen fû¥r kritische Infrastrukturen erhûÑht und die AufsichtsbehûÑrden mit neuen Befugnissen ausgestattet werden. Das IT-Sicherheitsgesetz 2.0 ergûÊnzt die Liste der kritischen Dienstleistungen um die Sammlung und Entsorgung von SiedlungsabfûÊllen. Neu ist, dass auch die Abfallwirtschaft zur kritischen Infrastruktur gezûÊhlt wird. IT-Sicherheit hat mehr denn je eine strategische Dimension und zûÊhlt damit zu den Themen, die ganz oben auf der Agenda stehen sollten.
Aufgeschoben, aber nicht aufgehoben: ôÏ 2 b des Umsatzsteuergesetzes
Ein weiteres aktuelles Thema fû¥r die Kommunalwirtschaft bleibt die Neuregelung der Umsatzbesteuerung und die damit verbundene Frage, welche UmsûÊtze der Umsatzsteuer unterliegen. Vollkommen û¥berraschend wurde die ûbergangsfrist fû¥r Kommunen und die Umsetzung der neuen Regelung Ende des letzten Jahres ein weiteres Mal verlûÊngert. Nach jetzigem Stand soll die Regelung dann ab dem 1.1.2025 verbindlich und ausnahmslos fû¥r alle Leistungen gelten, die steuerpflichtig und steuerbar sind.
Wer fû¥r die Einfû¥hrung des ôÏ 2b UStG noch nicht ausreichend gerû¥stet ist, hat mit der VerlûÊngerungsoption neue Zeit fû¥r eine umfassende Vorbereitung gewonnen. Um Risiken bei der Umsatzsteuerung mûÑglichst zu vermeiden, ist es entscheidend, die Unterschiede zwischen Hoheitsbereichen, Betrieben gewerblicher Art (BgA) und umsatzsteuerlichen Unternehmen umfassend zu kennen und zu verstehen. Sind die Vorbereitungen zur Einfû¥hrung von ôÏ 2b UStG inzwischen weit fortgeschritten oder weitgehend abgeschlossen, eignet sich die ûbergangszeit fû¥r TestlûÊufe.
Die BetriebsstûÊttenleitung ã ein Beruf mit vielfûÑrmigem Profil
Entscheidungen in der kommunalen ãZentraleã erfordern umfassende Kenntnisse in mehreren Bereichen, branchenspezifisches Wissen und ausreichend Erfahrung. Es gibt kein einheitliches Berufsbild in Sachen BetriebsstûÊttenleitung. Deshalb ist eine strukturierte Aus- und Weiterbildung wichtig. Um fû¥r alle beruflichen Herausforderungen gewappnet zu sein, besteht unsere Fortbildung Leitung BetriebsstûÊtte aus sieben Modulen. ãUnser Fortbildungsplan strukturiert die umfangreichen Aufgaben in kommunalen Dienstleistungsbetriebenã, so Dr. Hans-Peter Obladen, GeschûÊftsfû¥hrer der Akademie. ãZiel ist es, dass die Teilnehmerinnen und Teilnehmer die erforderlichen rechtlichen und betriebswirtschaftlichen Instrumentarien fû¥r eine professionelle BetriebsstûÊttenleitung kennenlernen. Dieses Wissen vermeidet Fehler und senkt die Kosten.ã
Jedes der sieben Ausbildungsmodule erfordert eine Arbeitswoche und ist frei und unabhûÊngig voneinander buchbar. Die Dauer des Gesamtlehrgangs richtet sich somit flexibel nach den individuellen MûÑglichkeiten. Die nûÊchste Lehrgangswoche beginnt am 22. Mai und deckt alle rechtlichen Grundlagen der Kommunalwirtschaft ab. Im Juni folgen dann die betriebswirtschaftlichen Basics.