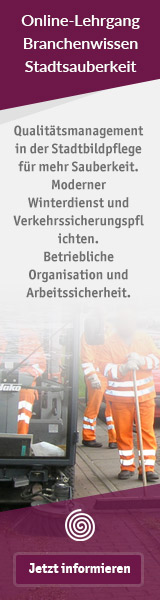Eine erste Bilanz nach einem Jahr

Vor einem Jahr war der Lockdown ein Schock. Heute sind Distanz und Homeoffice fast schon Gewohnheit.
Wir hoffen alle auf ein möglichst zeitnahes Impfangebot. Ein Ende der Restriktionen scheint greifbar zu sein. Es darf jetzt nur keine Rückschläge geben. In den Medien erscheinen derzeit Rückblicke auf ein Jahr Pandemie. Was genau artikulierten und versprachen Politik und Wissenschaft vor einem Jahr? Wie haben sich Einsichten und Meinungen verändert? Im Fazit sind diese Artikel oft eine Ansammlung von dokumentierten Fehleinschätzungen und Anklagen über Fehlentscheidungen. Wir befinden uns in einem Superwahljahr. Viele denken darüber nach, wem sie vertrauen können. Insofern ist die aktuelle Situation durchaus etwas explosiv.
Die Krise als Katalysator der Digitalisierung
Die digitale Transformation geht aus diesem Jahr als Mega-Trend hervor. Wir wussten zwar schon lange vor der Pandemie, wie gering unsere Fortschritte auf diesem Feld bislang ausfielen. Doch hat dies nur wenige gestört. Die Mehrheit zeigte sich vor der Krise allem Digitalen gegenüber kritisch und zurückhaltend. Heute fordern Personen aus der Spitzenpolitik ein Digitalisierungsministerium mit Querschnittsbefugnissen. Klingt gut.
Vor wenigen Tagen startete die "Initiative Digitale Bildung". Angela Merkel sagte bei der Vorstellung dieser Initiative: „Unser Leben ist digitaler geworden. Kinder und Jugendliche sind jetzt über eine lange Strecke digital und zu Hause unterrichtet worden. Studierende lernen in virtuellen Hörsälen. Berufstätige diskutieren mit Kolleginnen und Kollegen von zu Hause aus über Videokonferenzen. Das alles ist aus der Krise dieser Pandemie geboren, aber wir können es auch als Rückenwind sehen. Rückenwind, den wir nutzen wollen, um der digitalen Bildung in Deutschland einen kräftigen Schub zu verleihen."
Initiativen dieser Art haben mit Sicherheit Rückenwind. Ob der Wandel aber zu einem Selbstläufer wird? Da sind Zweifel angebracht. Leider ist die aktuelle Situation durch Zwang geprägt. Die Hörsäle sind ebenso wie Sitzungsräume in den Betrieben geschlossen. Die Nutzung digitaler Formate ergab sich weitgehend aus der Notwendigkeit und weniger aus Überzeugung heraus. So haben wir uns mehrere Monate lang mit digitalem Lernen und mit Videokonferenzen vollkommen unfreiwillig arrangiert. Spannend wird es, wenn in einigen Monaten die Normalität wieder Gebiete zurückerobert. Wie viel wird digital bleiben und wie viel davon wird Geschichte?
Unterschiedliche Einstellungen zur digitalen Transformation
Der dauerhafte Erfolg digitaler Bildung wird von der persönlichen Flexibilität und der digitalen Reife abhängen. Wir haben es seit Beginn der Pandemie mit vier unterschiedlichen Gruppen zu tun.
- Attentismus: Hoffentlich ist die Pandemie bald besiegt, und es kehrt wieder Normalität ein. Warten wir einfach ab. Diese Personen haben viel mit sich selbst zu tun, verkriechen sich in ihr Schneckenhaus und warten auf bessere Zeiten. Ihre Aufmerksamkeit ist nach Innen gerichtet. Sie sehen nicht ein, ihr Leben und ihren Alltag anpassen zu müssen.
- Pragmatismus: Es muss ja irgendwie weitergehen. Diese Personen arrangieren sich damit, was ihnen zur Verfügung gestellt wird. Vermutlich bleiben ihre Leistungen im Homeoffice unterhalb ihrer Möglichkeiten. Mal fehlt hier etwas, dann dort. Es wird schon einen guten Grund haben, dass sich viele Fachpublikationen mit der Führung virtueller Teams befassen.
- Enthusiasmus: Die Möglichkeiten haben zugenommen und werden auch voller Zufriedenheit genutzt. Die Arbeitszeiten sind jetzt weitgehend kompatibel mit persönlichen Präferenzen. Der Wegfall von Arbeitswegen und nervtötenden Staus ist ein Glücksfall. Es ist möglich an einem Seminar teilzunehmen, ohne dafür mehrere Stunden unterwegs sein zu müssen. Die Freiheitsgrade und Optionen haben erheblich zugenommen. Diese Personen profitieren von der Pandemie. Es wird ihnen schwer fallen, Teile dieser lieb gewonnenen Annehmlichkeiten wieder aufzugeben.
- Agilität: Pandemie, hin oder her. Wir müssen zwingend bei den wirklich wichtigen Themen Fortschritte erzielen. Themen wie Klimaschutz, Nachhaltigkeit, Ressourcenschutz oder Partizipation, um nur einige zu nennen, dürfen einfach nicht unter die Räder kommen. Diesen Personen ist das Ergebnis wichtiger als der Weg dahin. Sie glauben an den Nutzen der digitalen Transformation für ihr Anliegen und zeigen sich beweglich.
In welchem Umfang sich die Beschäftigten in Deutschland auf diese vier Gruppen verteilen, können wir nur raten. Es ist aber zu befürchten, dass die Gruppe mit einer abwartenden Haltung groß ist. Dann hätte es die Initiative Digitale Bildung sehr schwer. Deshalb erscheint es sinnvoll, sich auf die obere Spalte der digitalen Reife zu konzentrieren. Der Nutzen muss größer sein als der Aufwand. Und Digitalisierung darf kein Selbstzweck sein. Daran arbeiten wir gerne mit. Ideen haben wir viele.